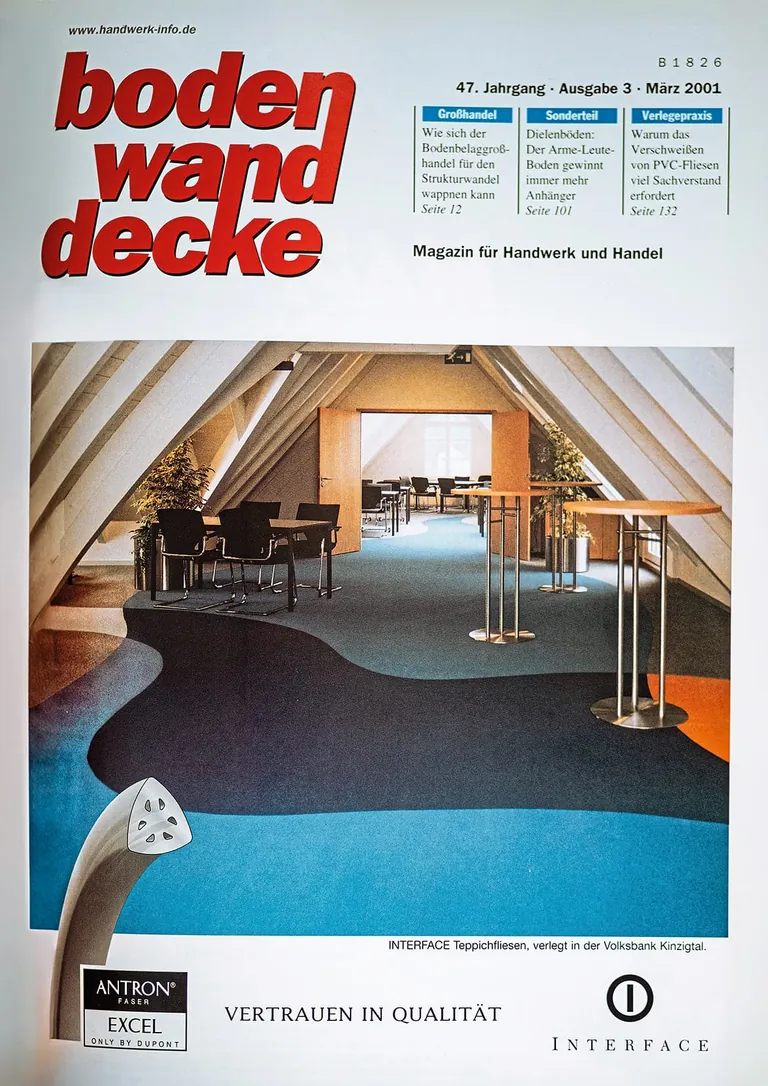In der ersten Dekade des neuen Jahrtausends verlieren Parkett- und Estrichleger im Zuge der Handwerksnovelle die Meisterpflicht, mit gravierenden Folgen. Laminatbeläge überschreiten ihren Zenit und Exotenhölzer bei Parkett werden immer beliebter. Erstmalig wird die KRL-Messung als Alternative zur CM-Messung ins Spiel gebracht.
Für den deutschen Schriftsteller und Kolumnist Maxim Biller steht der Laminatfußboden für den Zeitgeist der Nullerjahre und seinem digitalisierten Lebensgefühl, wie er rückblickend im Februar 2010 in der Süddeutschen Zeitung schrieb. Und in der Tat. Laminat beflügelt wie kaum ein Belag zuvor die Branche. Zu Beginn des neuen Jahrtausends hatten nahezu alle europäischen Laminatbodenhersteller auf leimfreie Systeme umgestellt und die Innovationskraft war ungebrochen.
Nachdem zur Jahrtausendwende der erste „leise Laminatboden“ vorgestellt wurde, feierten
- 2001 auf der Domotex die ersten Produkte mit Porensynchronstruktur Premiere.
- 2005 folgte als nächste bahnbrechende Innovation der direkt bedruckte Laminatboden.
- 2007 lag der Absatz der EPLF-Mitglieder bei über 507 Mio. Quadratmeter pro Jahr. Ein Höchstwert.
Allein im deutschen Markt wurden über 80 Mio. Quadratmeter Laminat abgesetzt. Einen Höhepunkt erreichten im Jahr 2007 auch die Auseinandersetzungen um Urheberrechte und Lizenzen bei den Klickverbindungen. Auf der Messe Domotex wurde im Zuge der Patenstreitigkeiten der Stand eines Anbieters per richterlicher Anordnung geschlossen.
Laminat stürzt ab
Mit der Menge und den Zwang, die gigantischen Produktionskapazitäten auszulasten, sollte bald jene teuflische Spirale in Gang gesetzt werden, an deren Ende nach Preisverfall, Sparzwang und Qualitätsverlust aus dem Must-Have-Produkt ein Ramschartikel wurde. Es deutet sich schon recht früh an, dass die Laminatindustrie den gleichen Weg gehen würde, wie mit einem Zeitvorsprung von etwa 25 bis 30 Jahren die Teppichbodenhersteller.
Laminatböden verlieren mittlerweile immer mehr ihre Ausstrahlungskraft, weil Baumarktpreise von 3,99 Euro/Quadratmeter für den Fachhandwerker schlichtweg unseriös sind. Man hat es zwar geschafft, eine eigene Fußbodengattung zu etablieren, aber nicht, vom Vorwurf des Plagiats wegzukommen. Man kopiert trotz beachtenswerter neuer Drucktechniken munter weiter. Auskömmlichkeit gelingt denjenigen leidlich, die ein entsprechendes Vertriebsnetz aufweisen, in dem man Differenzierungen deutlich machen kann, aber diejenigen, die für die Absatzmenge verantwortlich sind, bleiben Gefangene des eigenen Outputs.
Und was tat sich beim Parkett?
Deutschland importiert zu Beginn des 21. Jahrhunderts Parkett aus allen Teilen der Erde, der Tropenholzanteil ist relativ hoch, Zertifizierungssysteme tragen nachhaltigere ökologischere Früchte und bwd-Redakteure treten immer wieder Reisen an, um ausführlich über die neuen Hölzer und deren Herkunft zu berichten. In bwd erscheinen Reportagen aus Lieferländern wie Bolivien, Malaysia, Thailand, Indonesien, Australien, Brasilien, Chile, Surinam oder nordamerikanische Regionen.
Und: Ein uralter Werkstoff aus China klopft im Fußbodenbereich an und wird in bwd mit allen seinen Eigenschaften wissenschaftlich vorgestellt. Mehrere Recherche-Reisen in das Reich der Mitte und ausführliche Berichte über Bambus unterstützen hierzulande den Markteinstieg des Wundergrases. bwd-Redakteur Walter Pitt wurde während einer Recherchereise nach China gar in eine lokale Fernsehsendung eingeladen. Diese hatte gemessen an der Quote weit mehr Zuschauer als der seinerzeitige Gassenfeger „Wetten Dass“ in Deutschland. Warum interessieren sich die „Langnasen“ plötzlich für Bambusböden?

Zur Jahrtausendwende hin hat bwd die Verbindung zur Wissenschaft intensiviert. So lässt bwd in Zusammenarbeit mit dem damals noch unter „Zentralverband Parkett- und Fußbodentechnik“ firmierenden heutigen Bundesverband Parkett und Fußbodentechnik die „Plastische Verformung von Holz bei behinderter Quellung“ untersuchen, ein Phänomen, das im Zusammenhang mit der holztypischen Fugenbildung weitere abgesicherte Daten bringt.
Außerdem beschäftigten Themen wie europäische Normung, CE-Kennzeichnung und auch Innenraumbelastungen die Branche. Die Verwaltungsaufgaben für die Marktbetreiber werden immer höher, Vorschriften wachsen ins uferlose und Europa setzt viele Vorgaben, die nach und nach in nationales Recht umgesetzt werden müssen. Für das Handwerk werden die bürokratischen Herausforderungen immer größer.
Das Handwerk verliert
Die Handwerksnovellierung 2004 geht über diese Benachteiligungen hinweg. Estrich- und Parkettleger verlieren die Meisterpflicht, jetzt kann jeder, der einen Gewerbeschein erwirbt, die Arbeiten anbieten, ohne nachgewiesene Kenntnisse und Auflagen. Die Menge der neuen zumeist Ein-Mann-Betriebe steigt unverhältnismäßig, die Zahl der Mitarbeiter in den traditionellen Unternehmen sinkt in nahezu gleichem Maße. Die Schadensfälle nehmen in den Folgejahren deutlich zu. Nicht jede Garagenfirma, die von heute auf morgen Bodenbeläge verlegt, tut dies fach- und sachgerecht. Doch weder die Bodenbelagshersteller noch die Verlegwerkstoffindustrie kann die „neuen Kunden“ ignorieren. Die Folge: Man setzt alles daran, Produkte zu entwickeln, die in der Anwendung idiotensicher sein sollen. Das alles sehr zum Unmut der professionellen Bodenhandwerker, die in den wie Pilze aus dem Boden schießenden „Hausmeisterservice-Betrieben“ eine Konkurrenz sehen.
Nach dem Wegfall der Meisterpflicht sinken die Ausbildungszahlen in den betroffenen Gewerken erheblich. Im Parkettlegerhandwerk sollte die Zahl der Auszubildenden bis 2008 um 30 Prozent zurückgehen, die der Meisterabsolventen gar um 55 Prozent.
Messung der Belegreife von Estrichen - ein Dauerbrenner
Ein Thema, das zum Dauerbrenner der vergangenen 60 Jahre gekürt werden könnte, kocht wieder hoch. Es geht um die Feststellung der Estrichbelegreife. Bei bestimmten Estrichen ergeben sich unerklärliche Schadensfälle. Unerklärlich deshalb, weil die Belegreife mit dem CM-Gerät nachweislich überprüft worden war, und dennoch Feuchteeinflüsse von der Unterseite die Fußböden schädigten. Schadensfälle, die exklusiv und sehr ausführlich in bwd veröffentlicht werden, thematisieren die Problematik. Es stellt sich heraus, dass beschleunigte Estriche eigenen Gesetzmäßigkeiten folgen und die traditionellen Messungen nicht immer brauchbare Ergebnisse bringen.
Die Industrie reagiert mit eigenen Vorgaben für die Prüfungen und mutete der Branche individuelle Rechenexempel zu, um ein Ergebnis zu verifizieren. Das Sachverständigenwesen sieht sich folgerichtig nach neuen Feuchtemessmethoden um und wird im Ausland bei der korrespondierenden Luftfeuchtemessung (KRL-Messung) fündig, ohne bereits aussagefähige Grenzwerte zu kennen.
Zusätzlich gibt es Änderungen bei den Zementen, die der Vielfalt der Einflussgrößen auf die Estrichtrocknung noch eins draufsetzen. Der Bodenleger ist mit der Beurteilung der Vorleistung zunehmend überfordert und verlangt Sicherheit durch das Vorgewerk mit entsprechender Verschiebung der Verantwortlichkeiten. Zu diesem Zeitpunkt hatte man sich kaum vorstellen können, dass die Diskussion um die „richtige“ Messmethode im Laufe der kommenden Jahre eine Sprengkraft entwickeln würde, die inzwischen zur schieren Zerreißprobe in den bodenlegenden Gewerken geraten ist.
Zusammenschluss misslingt
Erst einmal übten Estrich-, Parkett,- und Bodenleger, namentlich ihre Organisationen BEB und ZVPF (heute BVPF) noch den Schulterschluss, und schlossen sich unter dem Dach einer gemeinsamen Geschäftsführung zusammen. Allianzen von Berufsfamilien sind in dieser Zeit existenziell, deren Zusammenhalt allerdings durch vorgenannte Abhängigkeiten umgehend auf den Prüfstand gelangen. Parkett-, Boden- bzw. Estrichleger und Raumausstatter, allein ist jeder für sich viel zu schwach, um gehört zu werden. Das hat 50 Jahre vorher schon Erich Rosenbaum formuliert. Alle am Fußboden Beteiligten sollen ins gleiche Boot, am besten noch die Maler mit ihrem beachtenswerten Fußbodenverlege-Angebot dazu. Es gibt viele Treffen, Sitzungen, Gespräche. Allein den vom gemeinsamem Credo getragenen Zusammenschluss aller dieser Gewerke gibt es nicht, weil sich immer wieder Hinderungsgründe offenbaren und am Ende keine Organisation zugunsten eines größeren Ganzen zurückstecken wollte.
Im Fachgroßhandel für Bodenbeläge und Raumausstattung setzte in den Nullerjahren eine bis heute anhaltende Konsolidierung ein. Während die Zahl der Großhandelsunternehmen kontinuierlich abnimmt, steigt parallel dazu die Zahl der Verkaufsniederlassungen. Und dennoch: In der Finanzkrise 2007/2008 gehörte der deutsche Bodenbelags- und Farbengroßhandel zu den Gewinnern. Währen das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um drei Prozent sank, konnte der Großhandel Umsatzzuwächse realisieren. Wie Jahre später während der Corona-Pandemie beschäftigten sich die Konsumenten – Stichwort Cocooning – mit der Renovierung und Sanierung der eigenen vier Wände.