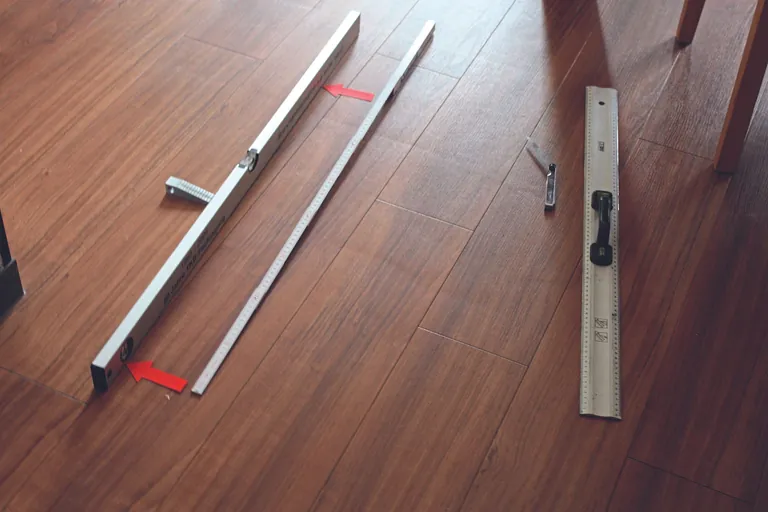Die nachfolgenden Ausführungen beschreiben die häufigsten Anlässe für Reklamationen an Bodenbelägen. In welchen Fällen muss der Kunde Unregelmäßigkeiten tolerieren? Wann handelt es sich um einen Mangel? Wie lässt sich Reklamationen vorbeugen?
Beim Streit über Unregelmäßigkeiten an Parkett und Bodenbelägen geht es meist um das optische Erscheinungsbild, die Auswirkungen von Maßtoleranzen, Unebenheiten, ungleichmäßiger Verlegung, Farbunterschiede, Fugenausbildung sowie kleineren Ausbesserungen u. ä.
Optisches Erscheinungsbild, Maßtoleranzen, Ebenheiten
Für die Beurteilung ist das Erscheinungsbild bei üblicher Raumnutzung maßgeblich. Die optische Einschätzung sollte daher in aufrecht stehender Haltung erfolgen, es sei denn, eine Betrachtung aus der Sitzposition ist gebrauchsüblich. Des Weiteren dürfen keine von üblichen Gebrauchssituationen deutlich abweichenden Lichtverhältnisse vorherrschen.
In der BSR-Richtlinie "Betrachtungsweise zur gutachtlichen Beurteilung des Erscheinungsbildes von Fußbodenoberflächen" heißt es unter anderem: „Grundsätzlich wird das Schadensbild aufrechtstehend betrachtet. Die Beurteilung ist bei üblicher Möblierung vorzunehmen. ... Werden Unebenheiten/Unregelmäßigkeiten aus einer Blickrichtung sichtbar, müssen diese zwecks Verifizierung der Beanstandungswürdigkeit aus einer weiteren, veränderten Blickrichtung gleichermaßen erkennbar sein. … Ein Fußboden ist kein Möbelstück; er ist ein Gebrauchsgegenstand, der in aller Regel täglich beansprucht und belastet wird. Anforderungen an die Oberfläche, wie solche an ein Möbelstück gestellt werden, scheiden daher aus. Die Beurteilung der Oberfläche des Fußbodens geschieht in aufrechtstehender Haltung. Beobachtungen oder Abfühlen der Fußbodenoberfläche in kniender oder gebückter Haltung scheiden für die Beurteilung aus. Auch Schräglicht-Beleuchtungen und Lichtbrechungseffekte dürfen für eine Beurteilung nicht herangezogen werden, da diese Methoden der Zweckbestimmung eines Fußbodens völlig widersprechen.“