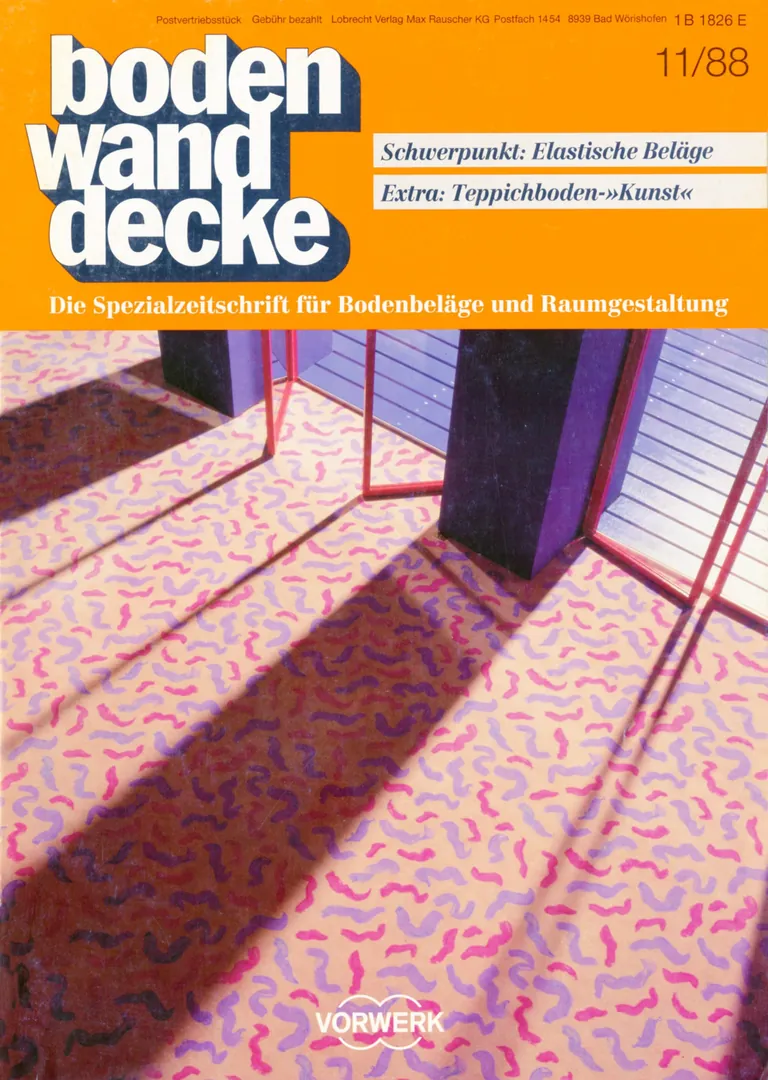Der Beruf des Bodenlegers wird endlich aufgewertet und die Fußbodenforschung liefert richtungweisende Erkenntnisse. bwd forciert mit dem Österreichischen Bodenlegerforum den engen Austausch mit der Fußbodenszene im Nachbarland.
Anfang der 80er Jahre startet bwd eine großangelegte Umfrage im Bodenbelagsgroßhandel mit sehr aufschlussreichen Ergebnissen für die Branche. Die Fragen sind in folgende Bereiche unterteilt: Markt und Umfeld, Vertrieb, Technik und Betrieb, Produktgestaltung und Innovation und Zusatznutzen.
- Mengenzuwachs bei gleichzeitigem Preisverfall,
- industrielle Rationalisierungsprozesse versus Kollektionierung und Bemusterung,
- Tuftingtechnologie weiterhin konkurrenzlos marktbeherrschend,
- begrenzte Variabilität in der Gestaltungsmöglichkeit trotz vorhandenem Kundeninteresse und
- Innovationen wie Antishading-Behandlung und Fluorcarbonausrüstung zur Verbesserung der Pflegeleichtigkeit
sind schlagwortartig die Themen, die analysiert werden. Eine Antwort aus der Umfrage, nämlich die, dass „die größte und dem Teppich dienlichste Verbesserung wäre, wenn alle Ware unterhalb der Schmutz- und Schundgrenze verschwände“, steht für die Situation, in der die Branche zu dieser Zeit steckt. Die Überschriften in bwd lauten:
- „Textilmarkt: Halbzeitbilanz ist nicht erfreulich“
- „Der Tuftingexport zeigt negative Tendenz“,
- „Berg- und Talfahrt der Konjunktur“ oder
- „Bei den elastischen erzielten nur die Objektbeläge einen Zuwachs“.
Bodenleger: staatliche Anerkennung
„Endlich ist der Weg frei“, formuliert Ortwin Baumann im Fachteil „Parkett und Fußbodentechnik“ im November 1982, in dem auch die Mitteilungen des Zentralverbandes Parkett- und Fußbodentechnik veröffentlicht werden.
„Es war ein langer und steiniger Weg, den staatlich anerkannten geprüften Bodenleger/geprüfte Bodenlegerin zu erreichen. Wenn auch das ursprüngliche Ziel des Bodenlegervollberufes nicht erreicht werden konnte, so ist das doch für alle die Männer und Frauen, die aus dem Bodenleger-Hilfsarbeiterstatus herauswollen, über diese Regelung festgelegt worden, dass sie sich aus der Masse der anderen tätigen Bodenleger deutlich sichtbar abheben - ausgestattet mit allen sozialen Vorteilen aller anderen staatlich anerkannter Berufe.
Ein wichtiger Baustein auf dem Weg dorthin war die Einrichtung der Bundesfachschule der Bodenbelagswirtschaft an der Handwerkskammer Koblenz. Insbesondere Erich Rosenbaum hat dazu beigetragen, dass viele Bodenleger zwischenzeitlich freiwillig den Bodenlegerbrief erwarben und dass zwischen Herstellern, Handwerk und den Verbänden eine Basis zur Erarbeitung der staatlichen Anerkennung Geprüfter vorhanden war, die auch dem Stand der Technik entspricht“, lobt Baumann seinen Kollegen und langjährigen Weggefährten. Rosenbaum, wegen seiner scharfen Zunge auch der „Max Merkel“ der Bodenbelagsbranche genannt, macht sich daneben zusammen mit seinem Mitarbeiter Norbert Strehle immer wieder um das Vermitteln Technischer Inhalte verdient.
Die beiden Experten verfassen im März 1984 eine grundlegende Arbeit zu bauphysikalischen Schutzmaßnahmen im Zusammenhang mit Fußbodenarbeiten, in der die erforderlichen Abdichtungsvarianten in Abhängigkeit von den baulichen Voraussetzungen beschrieben werden.
Eine ebenso wegweisende und auch heute noch in Sachverständigen und Fachveranstaltungen immer wieder zitierte Arbeit veröffentlichte Werner Schnell. „Zur Ermittlung von Belegreife und Ausgleichsfeuchte von mineralisch gebundenen Estrichen“ lautet die Überschrift eines Artikels zu einem Forschungsvorhaben, in der die Zusammenhänge zwischen der Belegreife und den Sorptionsisothermen verschiedener Estriche, ihrer Messmethoden und der Abhängigkeiten ihrer Ergebnisse fundiert erläutert werden. Keine Sorptionsisothermen und Vergleichskurven zwischen CM- und Darrprüfung sind wohl in der Fußbodenfachwelt so oft zitiert, wie jene aus Schnells Beitrag in bwd 1/1985.
Parkett kommt ins Spiel

Während der Teppichbodenmarkt Mitte der 80er Jahre (bwd 7/1984: „Der Teppichboden wird gekauft und deckt Wohnflächen ab, die für hochwertige Ware verloren sind“) durch Einflussfaktoren wie Importe, sinkende Durchschnittserlöse, geringere Gewinnmargen, Qualitätsverfall durch billige Rohstoffe, Verringerung des Floreinsatzgewichtes und der Dicke des Schaumes, Kaufzurückhaltung und eine beginnende Marktsättigung gekennzeichnet ist, kommt ganz allmählich das Parkett, wenn auch im Vergleich zu Teppichböden auf recht bescheidenem Niveau, wieder ins Spiel.
Seit Beginn der 80er Jahre ist der Inlandsverbrauch stetig gewachsen, die Konjunktur ist wieder ausgelastet und vor allem der Import erheblich angestiegen. Das liegt vor allem an Kooperationen mit ausländischen Herstellern und der Übernahme von Handelswaren von skandinavischen Fertigparkettproduzenten. 1985 beträgt der Inlandsabsatz etwa fünf Mio. Quadratmeter, mit etwa zehn Prozent Stabparkettanteil, 60 Prozent Mosaik- und 30 Prozent Fertigparkett, wobei Letzteres stetig wächst. Bemerkenswerterweise steigen nicht nur die Mengen, sondern auch die Preise. „Dass es den Herstellern und Verbänden gelungen ist, den Markt stabil zu halten, Preisdisziplin zu wahren, zukünftige Entwicklungen (wie das Anwachsen des Renovierungsanteils am Baumarkt) zu sehen und richtig darauf zu reagieren, das stimmt hoffnungsvoll und ist auch der Gemeinschaftswerbung zu verdanken“, heißt es in im Oktober 1986 in bwd. Die Fachzeitschrift nimmt das Thema Parkett in halbjährlichen Schwerpunktausgaben wieder auf. bwd berichtet dann über die aktuellen Entwicklungen, die da lauten: Wasserlack, der Trend zu hellen Hölzern wie Birke und zunehmend Dispersionskleber.
Lösemittelklebstoffe werden verharmlost
Das ist insofern von Bedeutung, als bei den Parkettklebstoffen ein Umdenken angezeigt ist. Nach Verlautbarungen des Fachverbandes der Deutschen Klebstoffindustrie (Düsseldorf) werden im Jahr 1986 noch rund fünfzig Prozent aller Kunstharz-Klebstoffe als Lösemittel-Klebstoffe hergestellt. Diese Situation steht in krassem Widerspruch zu den Bestimmungen der Gefahrstoffverordnung vom Oktober 1986. Danach sind in allen Fällen dort umweltfreundlichere und weniger gesundheitsgefährdende Klebstoffe einzusetzen und zu verarbeiten, also Kunstharzdispersionsklebstoffe, wo dies ohne besondere Nachteile möglich ist.
Der gesetzlich geforderte Substitutionsprozess der damals noch Methanol-gelösten Klebstoffe ist eingeleitet. Er wird aber noch viele Jahre in Anspruch nehmen, bis er in allen seinen Möglichkeiten in die greifbare Umsetzungsphase geht. Die ist allerdings nicht ohne Tücken. Anfang 1988 erscheint eine notwendige, aber, wie sich später herausstellt, nichtzutreffende Information über die Funktionsfähigkeit eines Pulverklebers im Zusammenhang mit Holzpflaster. Nahezu gleichzeitig wird in bwd über ein Urteil berichtet, das sich nach fünf ähnlichen Gutachten zur nachstoßenden Feuchte aus Rohbetondecken mit den Folgen fürs Parkett auseinandersetzt. Ein Parkettleger darf sich darauf verlassen, dass sich unter dem Estrich ein ordnungsgemäßer Beton befindet. Dass allerdings der Estrich sich nachträglich verändert, steht auf einem anderen Blatt. Erheblicher Forschungsbedarf besteht, diese Diskrepanz zu lösen. bwd ist in den Folgejahren hautnah dabei. Andreas Rapp, damals noch nicht promoviert, geschweige denn habilitiert, bietet fundamentale Unterstützung. Er hilft auch später mit exklusiven bwd-Beiträgen wie zur Ausgleichsfeuchte von Holz, zur Räuchereiche oder Thermobehandlung den Parkettlegern weiter.
Fließestriche gewinnen an Bedeutung
Die Estrichthemen kreisen zu der Zeit rund um Fließestriche, die immer mehr an Bedeutung gewinnen, und ganz speziell um die Oberflächenbehandlung von Anhyditfließestrichen. Nicht nur die Technik, sondern die Verantwortung in der Gewerkekette wird zum Dauerthema. Wer macht was, wird es bezahlt und von wem, lauten die Fragen.
Österreichisches Bodenlegerforum seit 1987 in bwd
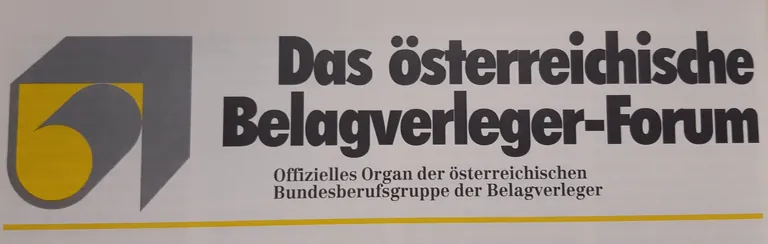
Seit 1987 gibt es innerhalb der 'boden wand decke' das Österreichische Bodenlegerforum. Die „Zeitschrift in der Zeitschrift“ ist, und das übrigens bis heute, das offizielle Organ der Bundesinnung der Bodenleger Österreichs. Zahllose, auch in Deutschland vielbeachtete Beiträge der sehr praxisorientierten Fußbodenexperten aus dem südlichen Nachbarland bereichern seitdem das bwd-Portfolio. Exemplarisch sei eine wichtige Untersuchung des österreichischen Textilforschungsinstituts über produktionsbedingte Konstruktions- und Musterungstoleranzen bei textilen Fußbodenbelägen von Ing. Hanspeter Bauer genannt, der in seinem Forschungsvorhaben Informationen darüber gewinnt, was technisch machbar und vor allem welche Abweichungen zu tolerieren sind.